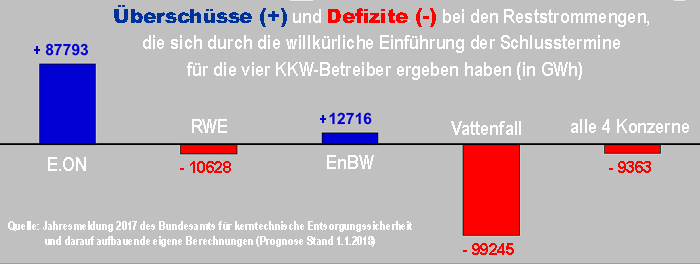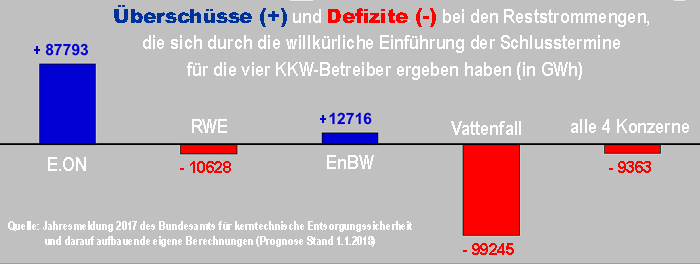 |
| Insgesamt beläuft sich die Reststrommenge, die wegen der falsch
kalkulierten Abschalttermine für die Reaktoren nicht abgearbeitet
werden kann, auf weniger als zehntausend Gigawattstunden (GWh) und ist
damit vergleichsweise bescheiden (siehe 180202).
Die Kernkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2, die Ende 2022
als letzte vom Netz gehen sollen, können zusammen monatlich etwa
6900 GWh erzeugen. Eine Verlängerung ihrer Laufzeit um zwei Monate
würde also ausreichen, um die Reststrommengen komplett abzuarbeiten.
Voraussetzung ist allerdings, dass den KKW-Betreibern E.ON, RWE, EnBW
und Vattenfall ein konzernübergreifender Ausgleich sämtlicher
Reststrommengen auferlegt wird. Aber das ist auch bei der Entschädigungsregelung
vorgesehen, welche die Bundesregierung plant, denn sonst würde allein
die Reststrommenge von Vattenfall einem Börsenwert von etwa 3,5 Milliarden
Euro entsprechen. |
Unnötige Abwrackprämie für Kernkraftwerke
Bundesregierung will Konzerne für nicht abgearbeitete
Reststrommengen entschädigen, anstatt die falsch gesetzten Schlusstermine
zu korrigieren
(zu 180501)
Die atompolitische Pfuscherei der schwarz-gelben Bundesregierung, die von 2009
bis 2013 amtierte, kommt den Steuerzahler nachträglich teuer zu stehen.
Im vergangenen Jahr durften sich die vier Konzerne über 6.285.000.000 Euro
plus Zinsen freuen, die ihnen das Bundesverfassungsgericht mit der Rückzahlung
der Brennelemente-Steuer bescherte (170601). Nun haben
sie schon wieder Anlass, die Sektkorken knallen zu lassen: Die amtierende schwarz-rote
Koalition will ein anderes Urteil der Karlsruher Richter zum Anlass nehmen,
um eine Art Abwrackprämie für die letzten Kernkraftwerke einzuführen.
Wieviel das genau kosten wird, weiß man nicht, weil die Endabrechnung
frühestens in fünf Jahren vorgenommen werden kann. Das Bundesumweltministerium
spricht von Kosten "im oberen dreistelligen Millionenbereich". Es
könnten aber auch knapp vier Milliarden werden, falls die KKW-Betreiber
einen konzernübergreifenden Ausgleich ihrer Reststrommengen blockieren.
– Und das alles ganz ohne Not. Es würde nämlich den Anforderungen
des Bundesverfassungsgerichts vollkommen genügen und den Steuerzahler in
keiner Weise belasten, wenn man die drei letzten Kernkraftwerke einfach zwei
Monate länger laufen lassen würde, anstatt sie exakt zum 31. Dezember
2022 abzuschalten.
Gesetzgeber muss Mängel im Atomgesetz bis 30. Juni beseitigen
Es geht um das Urteil vom Dezember 2016, mit dem die Karlsruher Richter den
Gesetzgeber zur Änderung des geltenden Atomgesetzes verpflichteten, weil
die Schlußtermine für die sukzessive Abschaltung aller Reaktoren
in § 7 Abs. 1a von der
schwarz-gelben Bundesregierung zu knapp bemessen wurden, um die im selben Paragraphen
zugesicherten Reststrommengen restlos abarbeiten zu können. Ferner vermissten
die Karlsruher Richter eine Regelung, welche die KKW-Betreiber für "frustrierte
Investitionen" entschädigt, die sie im Vertrauen auf die Dauerhaftigkeit
der Laufzeiten-Verlängerung vorgenommen haben, die Union und FDP kurz vor
der Katastrophe von Fukushima beschlossen hatten (161201).
Diesen Mängeln will die schwarz-rote Koalition nun abhelfen, indem sie
im Atomgesetz den KKW-Betreibern einen finanziellen Ausgleich für nicht
abgearbeiteten Reststrommengen zukommen läßt (§
7f) und außerdem einen Entschädigungsanspruch für solche
Ausgaben anerkennt, die ohne die Laufzeiten-Verlängerung unterblieben wären
(§ 7e). Es ist allerdings noch fraglich,
ob es solche "frustrierten Investitionen" in der kurzen Zeitspanne
zwischen dem 28. Oktober 2010 und dem 16. März 2011 überhaupt gegeben
hat. Die KKW-Betreiber werden diesbezügliche Ansprüche erst einmal
detailliert belegen müssen. Außerdem müssen die Investitionen
allein durch den atompolitischen Kurswechsel der schwarz-gelben Koalition entwertet
worden sein. Die Entschädigungen für die Reststrommengen werden dagegen
in fünf Jahren mit Sicherheit fällig, wenn der vorliegende Gesetzentwurf
verabschiedet wird.
Abfindung der KKW-Betreiber war anscheinend schon von der Vorgänger-Regierung
geplant
Seltsamerweise spielten die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts bei den
jüngsten Koalitionsverhandlungen keine Rolle, obwohl sie spätestens
bis zum 30. Juni dieses Jahres zu erfüllen sind. Auch im schließlich
unterzeichneten Koalitionsvertrag war keine Rede davon (180206).
Das läßt den Schluss zu, dass der jetzige Gesetzentwurf in den Grundzügen
bereits von der Vorgänger-Regierung vereinbart worden war und nur noch
aus der Schublade geholt werden mußte. Dafür spricht auch, wie die
Bundesregierung am 8. Februar eine gezielte Nachfrage von Abgeordneten der Linken
beschied: "Die Bundesregierung prüft gegenwärtig die Umsetzung
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts", hieß es in der Antwort,
die nur aus zwei Sätzen bestand. "Eine Verlängerung der Laufzeiten
einzelner Atomkraftwerke über die derzeit im Atomgesetz geregelten Enddaten
zur gestaffelten Beendigung der Nutzung der Kernenergie bis über das Jahr
2022 hinaus ist nicht Gegenstand der Prüfung." (180202)
Damit war klar, dass die schwarz-rote Koalition am Fetisch der Schlusstermine
festhalten will und auch riskiert, dass der Preis dafür nicht nur
neunstellig bleibt. Anfang Mai ließ sie – zunächst noch inoffiziell
- den dazugehörigen Gesetzentwurf kursieren. Das von der SPD geleitete
Bundesumweltministerium lieferte die Begleitmusik mit einem Argumentationspapier,
in dem behauptet wird:
"Der finanzielle Ausgleich ist die einzige Option, die den schnellstmöglichen
Atomausstieg gewährleistet und konsequent fortführt. Das entspricht
dem Grundgedanken des Atomausstiegs von 2011, der parteiübergreifend
beschlossen wurde. Eine Verlängerung der gesetzlichen Laufzeiten für
einzelne Kraftwerke würde diesem Grundgedanken widersprechen."
Re-Revision des Atomgesetzes hat den Ausstieg verzögert
statt beschleunigt
Das klingt gut, ist aber Schönfärberei und führt ohne nähere
Kenntnis der Zusammenhänge in die Irre. Tatsächlich geht es eher darum,
die Union nicht nachträglich zu kompromittieren. Die Schlusstermine für
die einzelnen Reaktoren, die diese 2011 gemeinsam mit der FDP ins Atomgesetz
schrieb, waren nämlich bestenfalls überflüssig. Sie beschleunigten
auch nicht den Ausstieg aus der Kernenergie. Man muß sich diese Schlusstermine
eher als Prokrustesbett vorstellen, das für die Konzerne entweder zu kurz
oder zu lang bemessen wurde. Im ersten Fall waren sie unzulässig, weil
die Abarbeitung der Reststrommengen Vorrang hat und dadurch behindert wird,
im zweiten waren sie sogar mehr als überflüssig. Das Bundesverfassungsgericht
hat deshalb in seinem Urteil die Korrektur bzw. Abschaffung der Schlusstermine
als billigsten Ausweg aufgezeigt.
Überhaupt war die Re-Revision des Atomgesetzes, wie sie nach der Katastrophe
von Fukushima erfolgte, nur insoweit ein Fortschritt, als sie wieder die alte
Reststrommengen-Regelung in Kraft setzte. Gegenüber der ursprünglichen
Fassung des Atomgesetzes war sie dagegen ein Rückschritt. Das lag gerade
an den beiden Zutaten, die den Anschein eines besonders raschen Ausstiegs aus
der Kernenergie erwecken sollten: Der sofortigen Stillegung von insgesamt acht
Reaktoren und den Schlussterminen, bis zu denen die einzelnen Reaktoren spätestens
abgeschaltet werden müssen. Vor allem die sofortige Stillegung von acht
Reaktoren mußte logischerweise den Ausstieg aus der Kernenergie verzögern,
anstatt ihn zu beschleunigen, denn dadurch standen fortan weniger Kapazitäten
zur Verfügung, um die gesetzlich zugesicherten Reststrommengen abzuarbeiten.
Maßgeblich für das Tempo des Ausstiegs blieben nämlich weiterhin
diese Reststrommengen, wie sie im Jahr 2000 mit den vier KKW-Betreibern ausgehandelt
worden waren. Die nachträglichen Zutaten änderten trotz ihrer Scheinradikalität
an diesem grundlegenden Mechanismus überhaupt nichts. Sie wirkten sich
aber kontraproduktiv auf sein Funktionieren aus.
Nur die Linke erkannte die Dürftigkeit der Neuregelung
Es stimmt allerdings, wenn das Bundesumweltministerium in seiner schönfärberischen
Darstellung behauptet, dass die Re-Revision des Atomgesetzes damals "parteiübergreifend
beschlossen wurde". In der Tat haben auch SPD und Grüne dafür
gestimmt. Sie beanstandeten lediglich, dass der schwarz-gelbe Gesetzentwurf
den Ausstieg noch nicht schnell genug vorantreibe. Sie unterstützten damit
den falschen Eindruck, dass es zumindest schneller vorangehen werde als vorher.
Lediglich die Linke wollte sich nicht in die schwarz-gelb-rot-grüne Einheitsfront
einreihen. Sie lehnte den Gesetzentwurf mit der Begründung ab, dass er
bestenfalls der alten Ausstiegsregelung entspreche. Ersatzweise beantragte sie,
den Atomausstieg im Grundgesetz zu verankern, um ihn unumkehrbar zu machen.
Aber das wurde vom Rest des Parlaments abgelehnt. (110601)
Die scheinradikalen, im Grunde rein propagandistischen Zutaten, mit denen die
schwarz-gelbe Koalition damals ihre Rückkehr zu der alten Reststrommengen-Regelung
kaschierte, haben ihre Wirkung bis heute nicht verloren. "Jede finanzielle
Entschädigung ist besser als Laufzeitverlängerungen für einzelne
Atomkraftwerke", erklärte beispielsweise die sonst sachverständige
Grünen-Abgeordnete Sylvia Kotting-Uhl, die im Bundestag dem Umweltausschuss
vorsitzt, jetzt zum Gesetzentwurf der Bundesregierung. Kritikwürdig fand
sie nur, dass Angela Merkel mit der Ende 2010 beschlossenen Laufzeiten-Verlängerung
"die Unterschrift der Konzerne unter den rot-grünen Atomausstieg leichtfertig
in die Tonne getreten" habe.
Die Laufzeiten-Verlängerung war aber nicht der einzige Sündenfall.
Außerdem konnte diese zumindest formalrechtlich nicht angefochten werden.
Dagegen fehlte Merkels Theaterdonner mit dem "Moratorium" für
die sieben ältesten Kernkraftwerke die Rechtsgrundlage, wie alle Verwaltungsgerichte
bis zur höchsten Instanz feststellten (140110).
Und die kurz darauf folgende Re-Revision des Atomgesetzes kombinierte die Rückkehr
auf das sichere Terrain der alten Reststrommengen-Regelung mit soviel undurchdachten,
widersprüchlichen und juristisch unzulässigen Zutaten, dass die
Novellierung in dieser Form vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand
haben konnte.
Rückkehr zum rot-grünen Ausstiegsmodell wurde mit
scheinradikalen Zutaten dekoriert
Zur Erinnerung: Die schwarz-gelbe Koalition spendierte mit Beginn des Jahres
2011 allen 17 Kernkraftwerken, die damals noch am Netz waren, eine überaus
üppige Aufstockung ihrer Reststrommengen. Für die sieben ältesten
Reaktoren ergab das eine Laufzeiten-Verlängerung um acht Jahre, für
die zehn neueren sogar um vierzehn Jahre (100901).
Schon zweieinhalb Monate nach Inkrafttreten des geänderten Atomgesetzes
(101214) kam es jedoch zu der Katastrophe in Japan
(110301). Die Bundeskanzlerin Merkel reagierte darauf
mit einer atompolitischen Kehrtwendung, indem sie die sieben ältesten Reaktoren
vorübergehend abschalten ließ, obwohl es dafür weder eine Rechtsgrundlage
noch zwingende Gründe gab (110302, 110303).
Dieser Theaterdonner dürfte zunächst hauptsächlich taktischen
Überlegungen entsprungen sein, da in drei Bundesländern unmittelbar
Landtagswahlen bevorstanden (siehe Hintergrund, Februar
2015). Erst nach dem Wahlsieg der Grünen in Baden-Württemberg, wo
die CDU zum ersten Mal seit 58 Jahren nicht mehr den Regierungschef stellen
konnte (110306), verfestigte sich die atompolitische
Kehrtwende der schwarz-gelben Koalition bis hin zur Rücknahme der Laufzeiten-Verlängerung
und Wiederherstellung der alten Reststrommengen-Regelung (110501).
Allerdings sollte es gerade nicht so aussehen, als ob Union und FDP reumütig
zur rot-grünen Ausstiegsregelung zurückkehren würden. Das im
Sommer 2011 neugefaßte Atomgesetz (110601) sanktionierte
deshalb nachträglich die rechtswidrige Stillegung der sieben ältesten
Kernkraftwerke und verfügte zusätzlich die Stillegung des Kernkraftwerks
Krümmel. Ferner wurden für jeden der noch verbliebenen zehn Reaktoren
ein Termin festgelegt, zu dem er spätestens stillgelegt sein mußte.
Das ganze wirkte damit so, als ob die Stillegung der Kernkraftwerke noch viel
radikaler vorangetrieben würde. Tatsächlich blieb aber nach wie vor
die alte Reststrommengen-Regelung maßgebend, die im Jahre 2000 die rot-grüne
Bundesregierung mit den vier Atomkonzernen ausgehandelt (000601)
und zwei Jahre später gesetzlich verankert hatte (011204).
Der Ausstieg aus der Kernenergie wurde sogar deutlich verzögert statt beschleunigt,
denn die Reststrommengen der stillgelegten acht Kernkraftwerke blieben ja erhalten
und mußten von den restlichen Reaktoren zusätzlich abgearbeitet werden.
Festsetzung der Schlusstermine erfolgte willkürlich und
unüberlegt
Propagandistischer Unsinn waren auch die Schlusstermine für die Reaktoren,
da die zugesicherten Reststrommengen in jedem Fall Vorrang hatten. Zudem konnte
kein KKW-Betreiber daran interessiert sein, die überaus günstigen
Erzeugungskosten für Strom aus abgeschriebenen Kernkraftwerken durch unnötige
Stillstände oder Abbremsung der Reaktoren hochzutreiben. Man konnte deshalb
die restlichen Laufzeiten der Reaktoren ziemlich genau auf Basis der ihnen zustehenden
Reststrommengen und der bisherigen Durchschnittserzeugung vorhersagen. Die Schlusstermine
hätten dann in jedem Falle so gesetzt werden müssen, dass sie
konzernintern eine restlose Abarbeitung der Reststrommengen ermöglichten.
Die schwarz-gelbe Koalition hat freilich arg geschlampt und fünfe gerade
sein lassen, als sie diese Hochrechnung vornahm: Für E.ON und EnBW ließen
die Schlusstermine noch viel Platz, um weitere Reststrommengen abzuarbeiten.
Der RWE-Konzern bekam diesen weiten Spielraum aber nur für seine real existierenden
Kernkraftwerke zugebilligt. Er kann deshalb einen kleinen Teil jener fiktiven
Reststrommenge nicht abarbeiten, die er bei der Einigung mit der rot-grünen
Bundesregierung dafür bekam, dass er den Genehmigungsantrag für das
KKW Mülheim-Kärlich sowie die Schadenersatzklage gegen das Land Rheinland-Pfalz
zurückzog (010602, 030906).
Anscheinend war die schwarz-gelbe Koalition der Meinung, dass sie von der
fiktiven Reststrommenge für ein längst nicht mehr existierendes Kernkraftwerk
ruhig etwas wegnehmen dürfe. Das war jedoch ein Irrtum, wie das Bundesverfassungsgericht
mit seiner Entscheidung vom Dezember 2016 klarmachte.
Vattenfall bekam überhaupt keine Möglichkeit zur
Abarbeitung seiner Reststrommengen
Noch dümmer stellte sich die damalige Bundesregierung an, als sie dem
Vattenfall-Konzern überhaupt keine Möglichkeit beließ, die ihm
zustehenden Reststrommengen für Krümmel und Brunsbüttel abzuarbeiten.
Schließlich hatte sie – aus bis heute unerfindlichen Gründen
– auch das KKW Krümmel auf die Liste der sofort stillzulegenden Kernkraftwerke
gesetzt, obwohl es noch relativ neu war und seine Reststrommenge erst 2019 abgearbeitet
hätte. Der Betriebsführer Vattenfall war deshalb darauf angewiesen,
dass sein Geschäftspartner E.ON – dem Krümmel zur Hälfte
und Brunsbüttel zu einem Drittel gehört – die Abarbeitung
der kompletten Reststrommenge übernehmen und einen kleineren Teil an EnBW
abgeben würde. So erklärt sich wohl auch der große Spielraum
bei den Schlussterminen für E.ON und EnBW. Es gab aber keinerlei gesetzliche
Verpflichtung oder Vereinbarung mit den Konzernen, um eine solche Übertragung
tatsächlich zu gewährleisten. Die Bundesregierung provozierte so jene
Klage auf 4,7 Milliarden Euro Schadenersatz, die Vattenfall 2014 beim ICSID-Schiedsgericht
der Weltbank in Washington einreichte (141001) und
im Oktober 2016 – ausnahmsweise – öffentlich verhandelt wurde
(161007, siehe auch Hintergrund,
Oktober 2016). Parallel dazu beschwerte sich Vattenfall – ebenso wie E.ON
und RWE - beim Bundesverfassungsgericht, das in seiner Entscheidung vom Dezember
2016 die auf Vattenfall entfallende Reststrommenge mit 46.651 Gigawattstunden
bezifferte und ausdrücklich festhielt, dass es keinen ersichtlichen Grund
für die vorgezogene Stillegung von Krümmel gegeben habe.
Anrufung des Washingtoner Schiedsgerichts kollidiert mit EU-Recht
Man darf gespannt sein, wie die Entscheidung des Washingtoner Schiedsgerichts
aussehen wird, nachdem auf Grundlage dieses Urteils nun auch Vattenfall entschädigt
werden muss. Eigentlich war der ICSID-Spruch schon für März erwartet
worden. Nachdem der schwedische Konzern trotz anfänglicher Zweifel an seiner
Legitimation (160302) erfolgreich vors Bundesverfassungsgericht
gezogen ist und die Karlsruher Richter die Zulassung der Klage mit europarechtlichen
Überlegungen begründet haben, ist es nun aber fraglicher denn je,
ob derartige private Schiedsgerichte bei Streitigkeiten innerhalb der Europäischen
Union überhaupt tätig werden dürfen. Es würde nämlich
eine Aushebelung und Entwertung des EU-Rechts bedeuten, wenn eine internationale
Privatjustiz die deutsche Regierung auf Grundlage der "Energie-Charta"
zu Schadenersatz an den schwedischen Staatskonzern Vattenfall verurteilen könnte.
Die EU-Kommission machte dies schon 2015 deutlich, indem sie dem seit 2012 anhängigen
ICSID-Verfahren als "Amicus Curiae" (Streithelfer) beitrat. Grundsätzliche
Bedenken gegen solche Schiedsverfahren zwischen Investoren und Regierungen innerhalb
der EU äußerte auch der Europäische Gerichtshof in einem Urteil
vom 6. März dieses Jahres. Es ging dabei um eine Schiedsklausel, die der
niederländischer Versicherungskonzern Achmea 1991 mit der Tschechoslowakei
bzw. der Slowakei als Nachfolgestaat vereinbart hatte. Aus Sicht der Luxemburger
Richter beeinträchtigt ein solches Schiedsverfahren die Autonomie des Unionsrechts
und ist deshalb nicht mit ihm vereinbar. Das dürfte ebenso für die
Klage von Vattenfall gelten.