 |
Foto: GPM
|
April 2016 |
Hintergrund |
ENERGIE-CHRONIK |
 |
Foto: GPM
|
(Zu 160403/ Siehe auch Hintergrund vom September 2009)
Vor sechs Jahren haben Bundesregierung und Industrie die "Nationale Plattform Elektromobilität" gegründet. Sie verkündeten dabei als Ziel, daß bis zum Jahr 2020 "mindestens eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren" (100505).
Das Elektroauto kam aber bei weitem nicht so in Fahrt, wie sie sich das vorgestellt hatten. Daran änderten auch mehrfache Griffe in den Subventions- und Fördertopf nichts (090310, 110507, 121011,150614). Zu Anfang dieses Jahres gab es gerade mal 25.502 Personenwagen mit reinem Elektroantrieb und 130.365 mit Verbrennungsmotor plus Elektromotor. Das sind insgesamt 155.867 Elektro-Pkw oder ein Anteil von 0,35 Prozent am Gesamtbestand aller Personenkraftwagen (siehe Grafik).
Inzwischen spricht die Bundesregierung nicht mehr von einer Million Elektroautos bis 2020, sondern wäre schon mit der halben Anzahl zufrieden. Zugleich hat sie erneut einen Griff in die Staatskasse beschlossen, um durch Prämien die Anschaffung der teuren Gefährte zu verbilligen und so wenigstens diese neue Zielmarke zu erreichen (160403).
Das zeigt, daß sie noch immer nicht begreifen will, an welchem Punkt es wirklich hapert. Schon die bisherige staatliche Förderung war im Ansatz verkehrt: Sie ignorierte geflissentlich, das die wünschenswerte Ersetzung des Verbrennungsmotors durch den Elektromotor bei Straßenfahrzeugen keine Frage des Marketings oder des Aufstellens von Ladesäulen ist. Es geht vielmehr um ein technisches Problem: Die Reichweite reiner Elektroautos ist noch immer viel zu kurz, um mit herkömmlichen Fahrzeugen konkurrieren zu können. Daran kann auch ein flächendeckendes Netz von Ladesäulen nichts ändern, solange das "Auftanken" Stunden statt Minuten dauert. Stattdessen müßten weitere Fortschritte bei den Akkumulatoren erzielt oder der Brennstoffzellen-Technik zum Durchbruch bei mobilen Anwendungen verholfen werden.
Mit der jetzigen Subventionsspritze setzt die Bundesregierung erneut und erklärtermaßen auf den "Skaleneffekt". So bezeichnet man in der Betriebswirtschaft eine Theorie, wonach vermehrter Absatz die Durchschnittskosten der Herstellung senkt und so den Endpreis für die Kunden sukzessive verbilligt. Ein gutes Beispiel sind Solaranlagen, die anfangs reine Geldvernichtung waren. Inzwischen kann der damit erzeugte Solarstrom sogar günstiger sein als der Strombezug aus dem Netz. Es mag sein, daß sich dieser Skaleneffekt auch bei Fahrzeugen mit Hybrid-Antrieb auswirkt, die sozusagen eine Verlegenheitslösung darstellen, um das Hauptproblem zu umgehen. Viele sogenannte Hybride verfügen sogar nicht einmal über einen Steckdosen-Anschluß (der neudeutsch als "Plug-in" bezeichnet wird), weil der Elektromotor lediglich den Verbrennungsmotor unterstützt und von diesem bzw. durch die Rekuperation beim Bremsen den Strom erhält. Hybrid-Fahrzeuge verkaufen sich deshalb schon jetzt fünfmal so gut wie reine Elektrofahrzeuge und bedürfen am wenigsten der Förderung. Das echte Elektroauto kommt auf diese Weise aber nicht nennenswert in Fahrt. Die hier bestehenden Hindernisse lassen sich nicht mit betriebswirtschaftlichen Patentrezepten aus dem Weg räumen. Auch Preissenkungen können nur sehr bedingt dazu beitragen, es für breite Käuferkreise attraktiver zu machen. Viel wichtiger sind wissenschaftliche Forschung und technische Entwicklungsarbeit, um die Reichweiten zu erhöhen und das "Auftanken" zu verkürzen.
|
|
In den zehn Jahren seit 2006 ist die Zahl der Elektro-Pkw auf deutschen Straßen um das zwanzigfache gestiegen. Beim Vergleich mit dem Gesamtbestand von insgesamt über 45 Millionen Pkw ergeben diese 155.867 Fahrzeuge aber nur einen sehr bescheidenen Anteil von 0,35 Prozent. Außerdem handelt es sich größtenteils um Hybrid-Fahrzeuge (rot), die sowohl einen Verbrennungsmotor als auch einen Elektromotor unter der Haube haben und häufig nicht mal über einen Steckdosen-Anschluß verfügen. Reine Elektro-Pkw (blau) erreichen gerade mal 0,06 Prozent am Gesamtbestand. Quelle: Kraftfahrtbundesamt
|
Die bisher gewährten staatlichen Hilfen für das Elektroauto füllten hauptsächlich die Taschen einer Industrie, die ohnehin schon prächtig verdiente, aber nicht ernsthaft gewillt war, sich langfristig vom Verbrennungsmotor als der üblichen Antriebstechnik für Straßenfahrzeuge zu verabschieden. Zwar konnte auch die deutsche Automobilindustrie das Elektroauto nicht einfach links liegen lassen. So bot Volkswagen den "Golf" schon Anfang der neunziger Jahre auch als "City-Stromer" an, und Daimler-Benz stellte 1994 einen Transporter mit Brennstoffzellen-Antrieb vor (940414). Es handelte sich aber eher um Pflichtübungen – so ähnlich wie bei den Solarmodulen und Windkraftanlagen, die sich damals jeder größere Stromversorger zulegte, um dann erleichtert feststellen zu können, daß die "additiven Energien" doch nicht in der Lage seien, Kohle- und Kernkraftwerke zu ersetzen.
Stromkonzerne wie Veba, RWE und Badenwerk waren damals deutlich stärker am Elektroauto interessiert als die Autohersteller. Das hatte den einfachen Grund, daß die Stromerzeuger einen zukunftsträchtigen Stromverbraucher entdeckt zu haben glaubten und diesen fördern wollten. In umweltbewußten Kreisen wurde das Elektroauto deshalb als "rollende Nachtspeicherheizung" verfemt. Inzwischen sieht man die Nachtspeicherheizung (sowie allgemein die Umwandlung von Strom zu Wärme) wieder etwas entspannter (130507). Und ihre angebliche Variante auf Rädern wäre sicher schon damals ein begrüßenswerter Fortschritt gewesen, wenn sie nur weit genug gerollt wäre.
Diese branchenspezifische Perspektive ging aber – insoweit war die Kritik berechtigt – mit einer Verengung des Blicks auf Batterien einher. An der Brennstoffzelle als Stromlieferant konnten Stromunternehmen allenfalls dann ein Interesse haben, wenn sie zugleich Gasversorger waren. Die Leistungsfähigkeit der Akkumulatoren blieb indessen trotz allerlei Versuchen und Neuentwicklungen wie die Zink-Luft-Batterie (940224) sehr unbefriedigend. Nach einem enttäuschenden Langzeitversuch mit diversen Elektrofahrzeugen auf der Insel Rügen (970217) schlief deshalb die zeitweilige Aufbruchstimmung in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wieder ein.
Etwas anders verlief die Entwicklung bei den Elektrorädern, die zu Anfang der neunziger Jahre erstmals in Serienfertigung auf den Markt kamen. Sie verkauften sich anfangs auch nur sehr schleppend. Nach und nach fanden aber immer mehr Käufer Gefallen an dem elektrischen Rückenwind, der sich zu ungefähr 95 Prozent nicht als reiner Elektroantrieb, sondern in der Form der unterstützenden "Pedelec"-Technik durchsetzte. Schon 2010 gab es in Deutschland mehr als eine halbe Million dieser Räder (111217). Inzwischen dürften es nach Schätzungen der Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) 2,5 Millionen sein. Allein 2015 wurden mehr als eine halbe Million verkauft.
Wie die Elektroautos profitierten die Elektroräder von den Lithium-Ionen-Batterien, die über eine sechsmal größere Energiedichte als die herkömmlichen Blei-Akkumulatoren verfügen und seit Beginn des neuen Jahrtausends zunehmend auch für Elektroantriebe verwendet wurden. Der damit erzielte Verkaufserfolg bei Fahrrädern ist bemerkenswert, läßt sich aber nicht einfach auf Personenkraftwagen übertragen, weil diese ganz anderen Ansprüchen genügen müssen und ungleich teuerer sind.
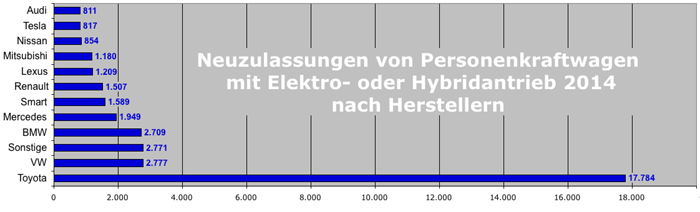 |
Von insgesamt 35.957 Fahrzeugen mit Elektro- oder Hybridantrieb, die 2014 in Deutschland neu zugelassen wurden, entfiel die Hälfte auf die Marke Toyota. Mit dem Hybrid-Modell "Prius" ließen die Japaner die deutschen Platzhirsche VW, BMW, Daimler und Audi weit hinter sich. Quelle: Kraftfahrtbundesamt
|
Die Haltung der deutschen Autoindustrie gegenüber dem Elektroantrieb erinnerte bis vor kurzem an die Blindheit der deutschen Energiekonzerne, die unentwegt auf Kohle und Kernkraft setzten, obwohl der Anteil der erneuerbaren Stromquellen von Jahr zu Jahr zunahm. Die Kraftwerksbetreiber konnten oder wollten sich einfach nicht vorstellen, daß eine erprobte und hoch entwickelte Technologie, die ihnen zumindest bis 2009 jährlich zweistellige Milliardengewinne bescherte (101003), so schnell obsolet werden könnte. Soeben mußte Vattenfall seine Braunkohlekraftwerke sogar verschenken und außerdem ein Aufgeld in Milliardenhöhe hinterherwerfen, um die teilweise hochmodernen Anlagen überhaupt loszuwerden (160401).
In ähnlicher Weise setzten die deutschen Autohersteller auf spritfressende "Sport Utility Vehicles" (SUV), als ob die ganze Umweltdiskussion an ihnen spurlos vorbeigegangen wäre. Wenn es mit der Einhaltung der Abgas-Normen nicht klappte, verwandten sie viel Scharfsinn darauf, dies zu verbergen und die Prüfer zu täuschen. Daß der angegebene Spritverbrauch ihrer Fahrzeuge nicht viel mit der Realität zu tun hatte, war dagegen noch nie ein Geheimnis. Man empfand das sogar als so normal wie den albernen Zehntel-Cent, mit dem die Tankstellen seit eh und je ihre Preise beschönigen.
Auch nach der Verabschiedung des "nationalen Entwicklungsplans Elektromobilität" im Jahr 2009 blieb das Verhältnis der Autohersteller zur Elektromobilität und den damit verbundenen Umweltzielen rein utilitaristisch: Gerne kassierten sie die nunmehr fließenden Subventionen und Fördergelder, taten aber nicht viel, um die Elektromobilität tatsächlich voranzubringen. Als ihnen im Rahmen des "Konjunkturpakets II" die Abwrackprämie spendiert wurde, die offiziell als "Umweltprämie" daherkam, war dies ein reines Förderprogramm für herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Dasselbe gilt für die aufwendige Ausschilderung der sogenannten Umweltzonen in größeren Städten, aus denen die Besitzer älterer Fahrzeuge verbannt wurden, sofern sie diese nicht nachrüsten lassen wollten oder konnten. Dabei hätte sich das löbliche Ziel der Feinstaub-Minderung viel einfacher und kaum weniger effektiv mit der Verschärfung der Vorschriften für neue Fahrzeuge erreichen lassen. Vollends zur Groteske gerieten die Umweltzonen dadurch, daß ausgerechnet die Angaben zum Schadstoff-Ausstoß der Neufahrzeuge nicht stimmten, weil sie von den Herstellern manipuliert worden waren.
Auf Trab gebracht wurde die hufende Branche erst durch die ausländische Konkurrenz. Inzwischen konnten die Lithium-Ionen-Akkumulatoren, die zuerst in Mobiltelefonen oder tragbaren Rechnern gute Dienste leisteten, auch für Elektrofahrzeuge verwendet werden. Das ermöglichte deutlich höhere Reichweiten. Schon vor zehn Jahren stellte die US-amerikanische Firma Tesla ihren Roadster vor, der mit 250 PS in vier Sekunden von null auf hundert beschleunigte und 240 Kilometer weit fuhr. Allerdings kostete er rund 100.000 Euro. Schon die Ersetzung der Lithium-Ionen-Batterie nach rund 500 Zyklen überforderte das Budget eines Normalverbrauchers.
Vor ein paar Wochen hat Tesla ein deutlich preisgünstigeres Modell vorgestellt, mit dem sich das Unternehmen ab Ende 2017 den Massenmarkt erschließen will. Das "Model 3" hat in der einfachsten Ausführung eine Reichweite von gut 345 Kilometern und beschleunigt in weniger als sieben Sekunden von null auf hundert. Der Preis von 35.000 Dollar (31.000 Euro) liegt noch unter den 37.000 Dollar, die General Motors für seinen "Chevy Bolt EV" verlangen will, der eine Reichweite von rund 320 Kilometer verspricht. Hinzu ermäßigen sich in beiden Fällen die Anschaffungspreise um die US-Förderprämie, die rund 7.500 Euro entspricht.
Die deutschen Autobauer, die bei konventionellen Fahrzeugen Weltspitze sind, können da kaum mithalten. Nach Angaben des Branchenverbands VDA haben sie zwar mittlerweile knapp dreißig Modelle im Angebot, wobei die Palette vom reinen Elektroauto bis zum "milden Hybrid" reicht, der allenfalls ganz kurze Strecken elektrisch fahren kann, weil sein Elektromotor und die schwach dimensionierte Batterie nur den Verbrennungsmotor unterstützen. Bei den Hybrid-Modellen wurden die deutschen Hersteller aber sogar auf ihrem Heimatmarkt vom japanischen Erfolgsmodell "Prius" an die Wand gedrückt (150614). Bald könnten ihnen ähnliches beim reinen Elektroauto passieren. Zum Beispiel will General Motors seinen Bolt EV nach der Markteinführung in den USA auch hierzulande als Opel Ampera-e anbieten.
Ein wichtiger Impuls aus dem Inland dürfte die Blamage gewesen, welche die Branche im Oktober 2011 erlebte: Ein Außenseiter verblüffte Publikum und Fachwelt mit einer Lithium-Metall-Polymer-Batterie, die einen umgerüsteten Audi A 2 anstandslos die 605 Kilometer lange Strecke von München nach Berlin ohne Aufladen bewältigen ließ (110109). Entgegen anfänglichen Vermutungen handelte es sich nicht um einen Trick (110209). Allerdings sollen die Kosten der Batterie pro Kilowattstunde bei rund tausend Euro liegen. Das wäre fünfmal soviel wie bei Lithium-Ionen-Akkus, die an sich schon der teuerste Bestandteil eines damit ausgerüsteten Elektroautos sind (140512).
Mittlerweile sieht es so aus, als ob die deutschen Autohersteller doch aufgewacht seien. Beim Volkswagen-Konzern trug hierzu der Skandal um den Abgasbetrug bei, der das alte Geschäftsmodell in den Grundfesten erschütterte und noch unabsehbare Konsequenzen haben kann. Nun will man in Wolfsburg das Elektroauto zu einem neuen Markenzeichen des Unternehmens machen. Bis 2020 sollen zusätzlich zu den neun Elektro- und Hybridmodellen, die bereits im Programm sind, zwanzig neue Modelle angeboten werden.
Mit einer Vielzahl an Modellen ist es aber sicher nicht getan. Sie kann sogar kontraproduktiv sein. Und auch Preissenkungen sind nicht so entscheidend, wie vielfach angenommen wird. Wichtig ist vor allem, daß die Hersteller bei der Verbesserung der Reichweiten und des "Auftankens" mindestens soviel Gehirnschmalz verwenden wie früher bei der Manipulierung der Schadstoff-Messung, die bei reinen Elektrofahrzeugen sowieso entfällt.
Die jetzt von der Bundesregierung geplante Subventionierung des Kaufpreises von Elektrofahrzeugen ist so überflüssig wie ein Kropf. Sie bremst die notwendige Neuausrichtung der Branche eher als daß sie diese fördert. Für die Fahrzeughersteller ist sie nicht mehr als ein Mitnahmeeffekt. Zum Beispiel stammten die 2014 neu zugelassenen Elektroautos zu acht Prozent von Volkswagen. Wenn der Konzern in diesem Umfang auch anteilig an der vom Staat spendierten Subventionierung des Kaufpreises profitieren würde, wären das gerade mal 48 Millionen Euro. Das ist eher ein Klacks und sogar ein Witz, wenn man an die vielen Milliarden denkt, die VW im Zuge der Abgas-Affäre versenkt hat und noch versenken wird. – Oder an die märchenhaften Gehälter und Prämien, welche die Mitglieder des VW-Vorstands trotz aller Fehlleistungen weiterhin kassieren wollen.
Für die Steuerzahler summiert es sich aber schon, wenn ein Staat ständig die Spendierhosen anhat, um irgendwelche Unternehmen zu päppeln, die es gar nicht nötig haben oder an ihren Problemen selber schuld sind.